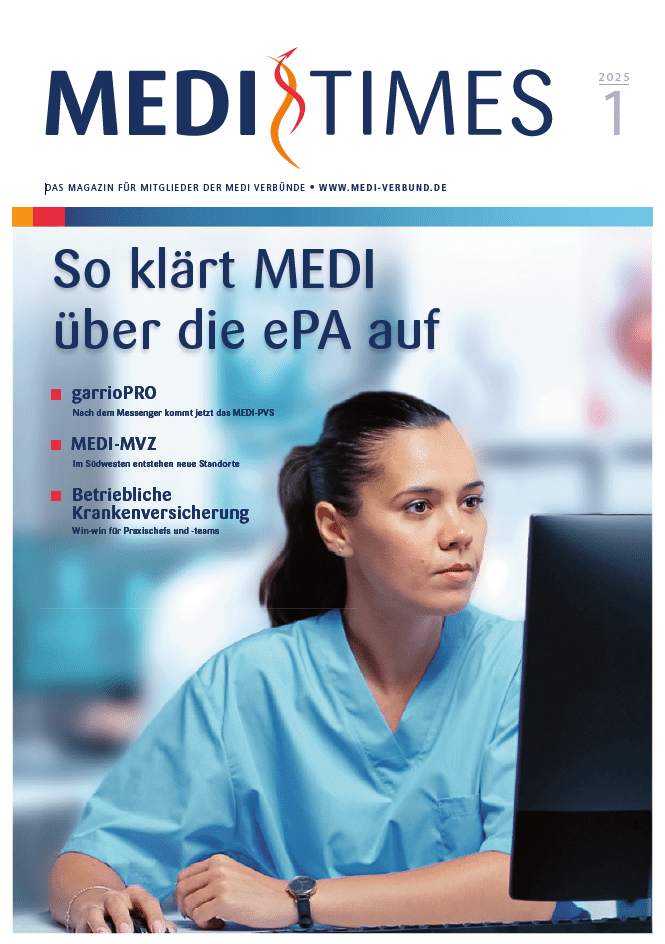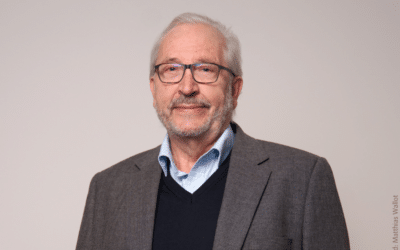Stress pur, wenn ein Vergewaltigungsvorwurf im Raum steht. Egal, ob er von der Partnerin, einer Geliebten, Mitarbeiterin oder Patientin kommt – der Ruf der Arztpraxis kann in Windeseile ruiniert sein.
Matthias Klein ist Strafverteidiger und als Fachanwalt für Straf- und Medizinrecht spezialisiert im Gesundheitssektor. Seine Mandanten sind Ärzte aus Kliniken und Praxen, die er nicht nur wegen Behandlungsfehlern und Wirtschaftsdelikten, sondern immer häufiger auch wegen des Vorwurfs eines Sexualdelikts verteidigen muss. „Für Betroffene ist ein Sexualdelikt eine Katastrophe“, so Klein. „Gleiches gilt aber auch für den, der einer Falschbeschuldigung ausgesetzt ist“, ergänzt er. Auch das ist Realität: Schon im Jahr 2008 schätzte der forensische Psychologe Günter Köhnken die Quote für falsche Aussagen angeblicher Opfer auf 30 bis 40 Prozent. Und der Hamburger Rechtsmediziner Christoph Püschel hält ein Drittel der ihm zur Untersuchung vorliegenden Fälle von angeblichen Vergewaltigungen für vorgetäuscht.
Kriminalpolizei am Praxisempfang
Was kann ein Arzt tun, wenn ihm fälschlicherweise ein Sexualdelikt vorgeworfen wird? Klein warnt eindringlich davor, in dieser Situation mit irgendjemandem über den Vorwurf zu reden – schon gar nicht mit der Kriminalpolizei. Er erlebt es immer wieder, dass die Beamten plötzlich am Empfang der Praxis oder in der Klinik auftauchen und den betroffenen Arzt unvermittelt mit den gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfen konfrontieren. Bei Sexualdelikten müssen zügig Spuren gesichert und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt werden, der Arzt muss mit aufs Präsidium kommen. Wenn vermeintliche Opfer eines Sexualdelikts beispielsweise weiter behaupten, sie seien nicht das erste Opfer oder es existiere auch Bild- oder Videomaterial, werden neben der Praxis auch private Wohnräume nach Speichergeräten durchsucht und Mobiltelefone, Tablets und PCs mitgenommen. „Es ist für Betroffene sehr schwer, in einer solchen Situation die Nerven zu bewahren“, weiß der Anwalt. Und die meisten würden einen gravierenden Fehler machen: Sie reden. Sie beantworten Fragen. Sie nennen Sperrcodes und Passwörter, weil sie glauben, die Sache so schnell aus der Welt schaffen zu können. „Das ist leider meist ein großer Irrtum“, warnt Klein. Er kennt den großen Rechtfertigungsdrang bei Falschbeschuldigungen und die Gefahr, sich in einer solchen Extremsituation um Kopf und Kragen zu reden.
Schweigen!
Der Strafverteidiger hält es für existenziell wichtig, dass Beschuldigte sofort einen spezialisierten Anwalt als Verteidigerin oder Verteidiger hinzuzuziehen, die oder der eingreift und sich schützend vor den Betroffenen stellt. „Das erhöht die Chancen, eine Falschbeschuldigung gleich am Anfang aufzudecken“, sagt Klein. Nur die Verteidigerin oder der Verteidiger erfährt alles, was die Polizei ermittelt hat, erhält Einsicht in die Akten der Ermittlerinnen und Ermittler und die Aussage des vermeintlichen Opfers. Und den Kontakt zur Verteidigerin oder Verteidiger seines Vertrauens darf die Polizei nie verwehren.
Klein erlebt immer wieder, dass Staatsanwaltschaft und Gericht bei drastischen Schilderungen unter Tränen mit scheinbar eindeutiger Spurenlage dazu neigen, dem vermeintlichen Opfer zu glauben. Es wird dann seltener kritisch hinterfragt, ob jemand tatsächlich Opfer ist. Schon der Verdacht eines Sexualdelikts führt häufig zu gesellschaftlicher Diskriminierung – bis hin zur Existenzvernichtung. Wenn ein Verfahren aber mangels hinreichendem Tatverdacht wieder eingestellt werden wird, erfährt dies die Öffentlichkeit selten.
Ruth Auschra