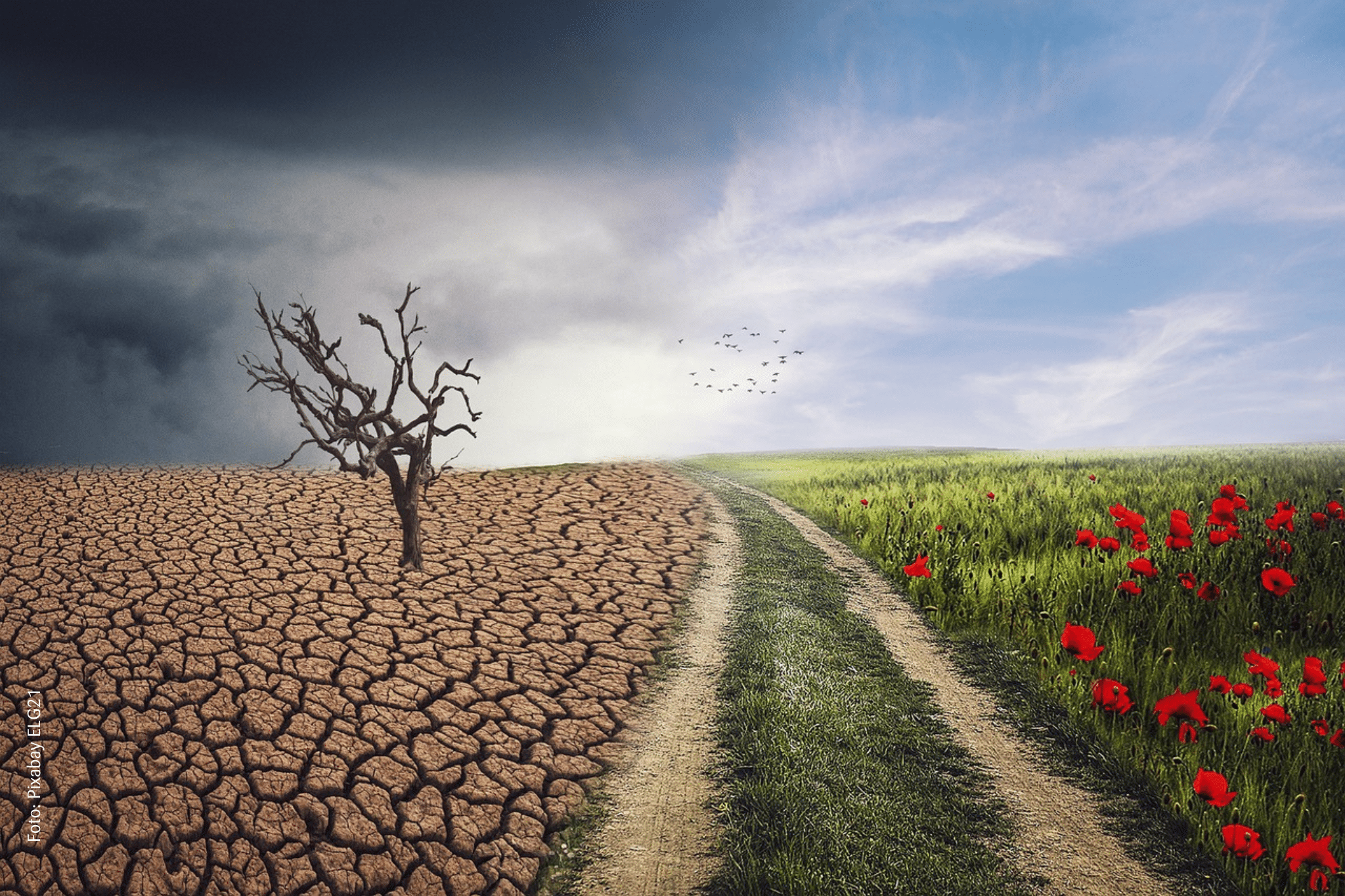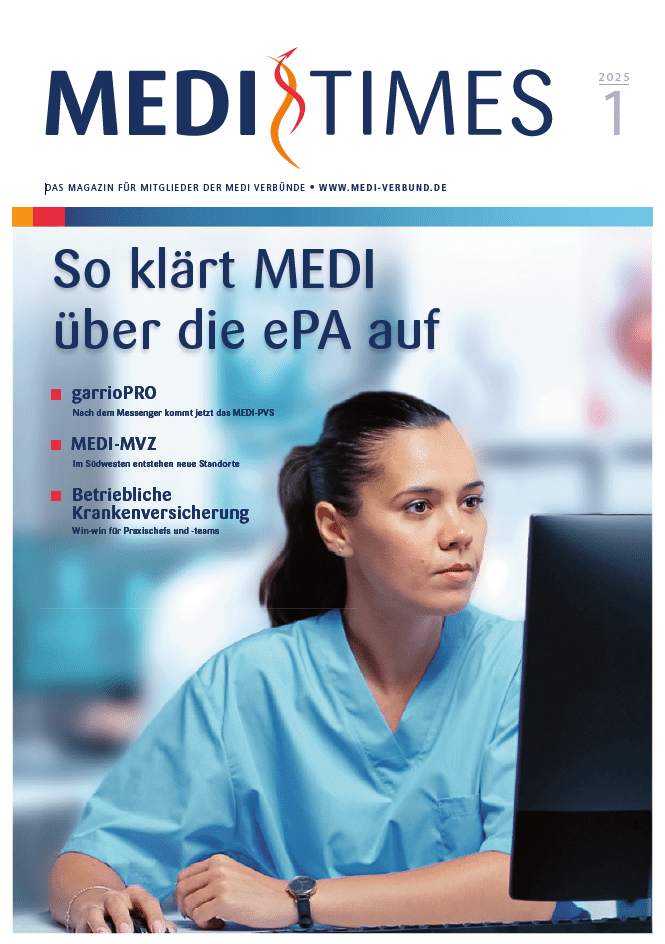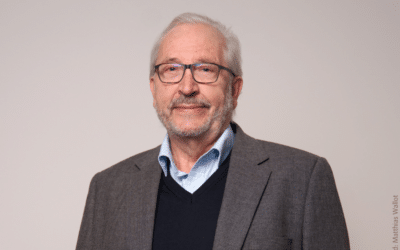Neben den gesundheitlichen Folgen für Patientinnen und Patienten durch steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse trägt das Gesundheitswesen selbst erheblich zu den globalen CO2-Emissionen bei. Daher stehen Arztpraxen vor zwei zentralen Aufgaben: ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren (Klimaschutz) und sich auf klimabedingte Gesundheitsprobleme vorzubereiten (Klimaresilienz).
In den vergangenen Jahren haben etliche internationale Studien aufgezeigt, dass das Gesundheitswesen weltweit für 4,4 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist und damit erheblich zur Erderwärmung beiträgt. Zu den maßgeblichen Faktoren zählen der Energieverbrauch in Einrichtungen des Gesundheitswesens ebenso wie die Produktion und der Transport von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie die Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. Die Arbeitsgruppe „Klimawandel“ der Bundesärztekammer hat daher bereits 2022 Handlungsfelder definiert, in denen Arztpraxen aktiv werden können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Ökologischen Fußabdruck der Praxis verkleinern
Wer die Klimabilanz seiner Praxis verbessern möchte, sollte sich zum einen dem Energiesektor widmen. Die Umstellung auf Ökostrom ist dabei nur ein Baustein – wer seine Arztpraxis in der eigenen Immobilie betreibt, kann durch die Installation von Photovoltaikanlagen selbst klimaneutralen Strom produzieren. Auch effiziente Heizsysteme, die ohne den Einsatz fossiler Energien auskommen – Stichwort Wärmepumpen – und energetische Sanierungen der Praxisräume können zur Reduktion von Emissionen beitragen.
Ein weiteres Handlungsfeld sind die Müllvermeidung und ein ressourcenschonender Materialeinsatz. Der Einsatz von Einwegmaterialien sollte, wo immer möglich, reduziert werden. Hierzu zählt beispielsweise der Verzicht auf Einmalhandschuhe, wenn deren Einsatz nicht indiziert ist. Zudem ist ein durchdachtes Recyclingkonzept für Verpackungen und medizinische Produkte sinnvoll. Bei der Beschaffung von Praxisbedarf sollte zudem verstärkt auf nachhaltige Medizinprodukte mit niedrigem CO2-Fußabdruck geachtet werden. Auch bei der Wahl von Pharmaka sollten Klimaaspekte berücksichtigt werden – etwa indem in der Asthmatherapie Pulverinhalatoren anstelle von Dosieraerosolen werden oder für Narkosen Sevofluran anstelle von Desfluran eingesetzt wird.
Dem Praxisteam umweltfreundliche Mobilität ermöglichen
Auch die Mobilität spielt eine entscheidende Rolle für den CO2-Fußabdruck von Arztpraxen. Mancherorts können Hausbesuche beispielsweise klimafreundlich mit dem Fahrrad oder E-Bike durchgeführt werden. Einige Praxen unterstützen ihre Mitarbeitenden durch Leasingangebote für E-Bikes, um den Umstieg auf eine umweltfreundliche Mobilität zu erleichtern. Gleichzeitig können digitale Sprechstunden dazu beitragen, Patientenfahrten zu vermeiden. Bei Reisen zu Kongressen sollte man versuchen, mit der Bahn anstelle des Flugzeugs zum Tagungsort zu gelangen.
Eine nachhaltige Praxisorganisation kann ebenfalls zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beitragen. Durch eine weitgehende Digitalisierung lassen sich Papierverbrauch und Druckkosten minimieren. Zudem können gezielte Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger Mehrfachuntersuchungen getroffen werden, indem beispielsweise ein koordiniertes Patientenmanagement die Notwendigkeit von Doppeluntersuchungen reduziert.
Klimaresilienz: Arztpraxen als Schutzschild gegen Klimafolgen
Daneben müssen Arztpraxen aber auch auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels vorbereitet sein. Hitzeperioden, Luftverschmutzung und neue Infektionskrankheiten sind Herausforderungen, die zunehmend den Praxisalltag beeinflussen. Ein entscheidender Aspekt ist daher der Hitzeschutz in der Praxis. Gerade für Risikogruppen wie ältere Menschen, Schwangere, Säuglinge und Menschen mit chronischen Erkrankungen kann extreme Hitze gefährlich sein. Arztpraxen können hier gezielte Maßnahmen ergreifen, etwa durch die Einrichtung spezieller Hitzesprechstunden, die es diesen Personen ermöglichen, frühmorgens oder abends Termine wahrzunehmen. Auch die Raumgestaltung spielt eine Rolle: Klimafreundliche Kühlungskonzepte und die Bereitstellung von Trinkwasser im Wartebereich können dazu beitragen, die Belastung für Patientinnen und Patienten sowie das Praxisteam zu reduzieren.
Darüber hinaus gewinnt die Patientenberatung zu klimabedingten Gesundheitsrisiken zunehmend an Bedeutung. Viele Medikamente können durch hohe Temperaturen in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Ärztinnen und Ärzte sollten daher gezielt darüber aufklären, wie Patientinnen und Patienten ihre Medikamente im Sommer richtig lagern. Zudem kann eine Beratung zu klimafreundlicher und gleichzeitig gesunder Ernährung dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten ihre eigene Gesundheit stärken und zugleich den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Auch die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf Atemwegserkrankungen sollten verstärkt thematisiert werden. Hierzu kann es sinnvoll sein, Patientinnen und Patienten den Einsatz von Luftfiltern oder Atemschutzmasken zu empfehlen.
Zuschlag zur klimaresilienten Versorgung in HZV-Verträgen
Gut zu wissen: Zumindest in den Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung (HZV) wird dieser Beratungsaufwand mit einem Zuschlag zur klimaresilienten Versorgung in Höhe von acht Euro honoriert. Für MEDI-Mitglieder gilt er derzeit im HZV-AOK-Vertrag und im zugehörigen Kinder- und Jugendarztmodul sowie in den HZV-Verträgen mit Bosch BKK/BKK LV sowie mit der GWQ. Der Zuschlag wird automatisch einmal im Kalenderjahr zur Ziffer für die Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten ausbezahlt, sofern eine Schulung mit Schwerpunkt „Klima und Gesundheit“ nachgewiesen wurde. Jasmin Ritter, Abteilungsleiterin Vertragswesen bei MEDI, erklärt dazu: „In den Facharztverträgen findet die Beratung zu einer klimaresilienten Versorgung Berücksichtigung bei den EFA®-Aufgaben, wird jedoch nicht mittels eines eigenen Vergütungszuschlags honoriert, sondern kalkulatorisch bei der Vergütungserhöhung des EFA®-Zuschlags zum 01.Oktober 2023 berücksichtigt.“
Neben diesen präventiven Maßnahmen ist es aber auch wichtig, Notfallpläne für Extremwetterereignisse zu erstellen. Dies betrifft unter anderem die Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei Stromausfällen oder Überschwemmungen. Praxisteams sollten regelmäßig im Umgang mit klimabedingten Notfällen geschult werden, um im Ernstfall schnell und effizient handeln zu können. Kooperationen mit lokalen Behörden und Rettungsdiensten können helfen, eine bestmögliche Versorgung von Patientinnen und Patienten auch unter extremen klimatischen Bedingungen zu gewährleisten.
Antje Thiel