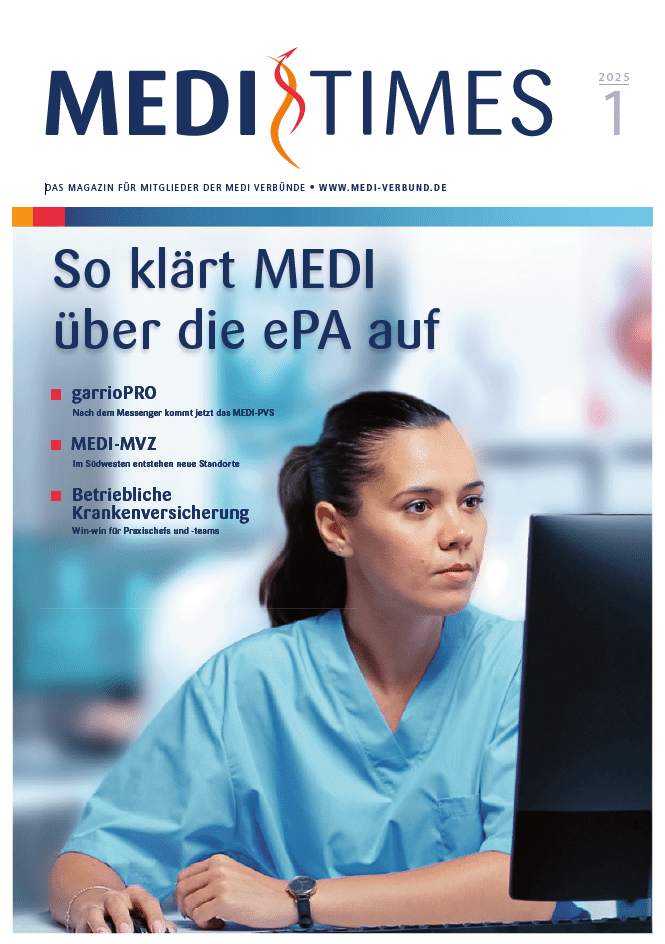Daniela-Ursula Ibach ist als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie in Filderstadt niedergelassen. Seit vier Jahren ist sie in der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg aktiv, jetzt ist sie zur Vizepräsidentin gewählt worden.
MEDI: Frau Ibach, Sie wurden zur Vizepräsidentin der Bezirksärztekammer Nordbaden gewählt – Glückwunsch! In den vergangenen Jahren waren Sie bereits Rechnungsführerin. Sie sind berufspolitisch aktiv, was treibt Sie an?
Ibach: Grundsätzlich habe ich den Wunsch, dass wir als Ärztinnen und Ärzte unsere Rahmenbedingungen mitgestalten. Die Politik hat einen engen Rahmen gesteckt, in dem wir Gestaltungsmöglichkeiten haben. Diese Möglichkeiten sollte man dann aber auch nutzen! Ich habe schon als Kind von meinen Eltern gelernt, dass es nicht reicht, nur zu schimpfen. Veränderungen müssen erarbeitet werden, das ist meine Überzeugung. Auch wenn es manchmal unbequem ist. Wir Ärztinnen und Ärzte haben eine Selbstverwaltung, die nur tragfähig ist, wenn wir dafür sorgen. Die Politik kennt jede Menge Begehrlichkeiten, aktuell wird viel über die Zukunft der Versorgungswerke diskutiert. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Solche Begehrlichkeiten unterstreichen die Wichtigkeit der Eigenständigkeit der Ärztekammern. Die Politik darf nicht über ärztliche Weiterbildung oder Digitalisierung entscheiden. Werner Baumgärtner hat jahrelang vor den TI-Konnektoren gewarnt, jetzt ist das Schlammassel da.
MEDI: Gibt es standespolitische Themen, die Ihnen besonders wichtig sind?
Ibach: Aktuell gibt es viele Probleme, allen voran die Mangelversorgung. Wir haben nicht nur zu wenige Ärztinnen und Ärzte, sondern auch im Bereich des nicht-ärztlichen Assistenzpersonals herrscht bitterer Mangel. Um die Versorgung zu verbessern, gibt es zwar erste Ansätze, aber noch keine wirklich tragfähigen Lösungen. Wir alle waren geschockt, als der Betten- und Personalmangel die Kinderkliniken fast kollabieren ließ. Im ambulanten Bereich sehe ich ähnliche Gefahren. Und ich setze mich dafür ein, dass mehr Frauen berufspolitisch aktiv werden.
MEDI: In der ambulanten Versorgung sind mittlerweile mehr Ärztinnen als Ärzte tätig. In den Ärztekammern überwiegen aber die männlichen Kollegen. Warum ist das so?
Ibach: Das ist leider ein Dauerthema. Wir haben einfach viel zu wenig Frauen, die sich berufspolitisch engagieren. Wenn überhaupt, dann finden die älteren Frauen die Zeit dafür. Das hat mit unseren Traditionen zu tun. Noch immer holen eher Frauen die Kinder aus der Kita ab und versorgen sie daheim. Die Mütter verbringen einfach mehr Zeit mit den Kindern. Wenn beide Eltern berufstätig sind, ist das Wochenende sozusagen heilig. Wochentags sieht man die Familie in der morgendlichen Hektik und hat abends vielleicht noch eine Stunde Zeit zusammen. Da ist das Wochenende automatisch kostbare Familienzeit. Und viele Sitzungen der Kammer finden nun mal am Samstag statt.
MEDI: Was würden Sie im deutschen Gesundheitswesen am liebsten ändern?
Ibach: Am wichtigsten ist die Verlässlichkeit, was die Bezahlung angeht. Die Streichung der Neupatientenregelung bringt die Einnahmen der Ärztinnen und Ärzte ins Wanken. Ganz grundsätzlich bin ich für eine andere Bewertung der Vergütung im ambulanten und stationären Sektor. Man darf sich ruhig mal anschauen, wie die Bezahlung in vielen unserer Nachbarländer funktioniert. Damit sind wir wieder beim Thema Versorgungsmangel: Wer will im Krankenhaus oder in der Praxis arbeiten, wenn die Honorierung nicht adäquat ist?
MEDI: Wagen Sie mal einen Blick in die Glaskugel: Was könnte oder müsste sich für die Ärztinnen und Ärzte ändern?
Ibach: Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche: Dass wir nämlich tatsächlich über die Grenzen der Sektoren und Fachgruppen hinweg zusammenarbeiten. Ärztinnen und Ärzte aus Praxis und Klinik sollten ohne Rücksicht auf die Fachrichtung an einem Strang ziehen. Von der Gesundheitspolitik und deren Planungen wünsche ich mir mehr Verlässlichkeit und damit auch mehr Respekt, mehr Konstanz und nicht immer nur Flickschusterei, wenn irgendwo ein Problem auftaucht.
Ruth Auschra