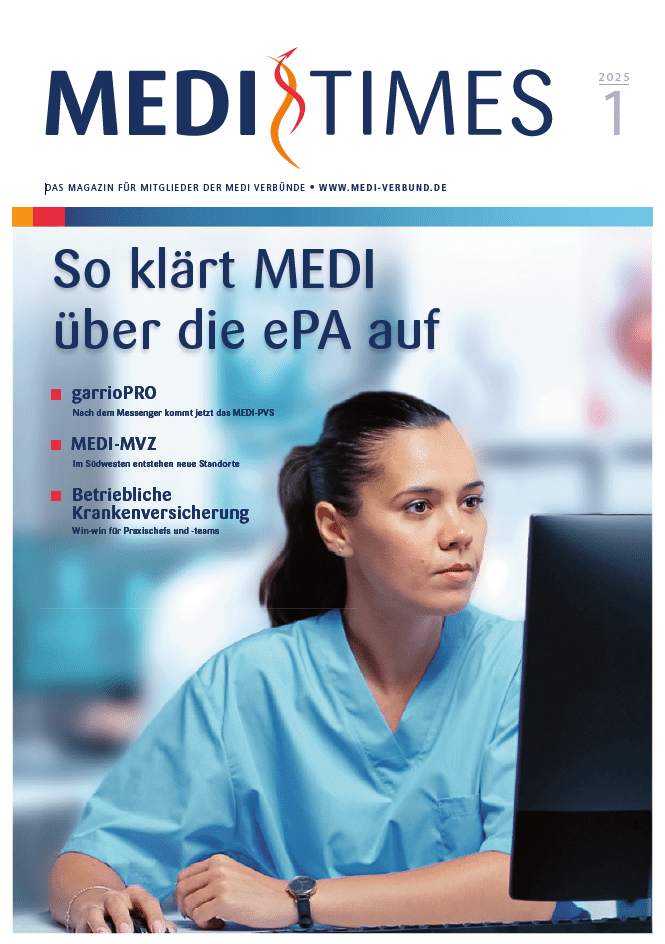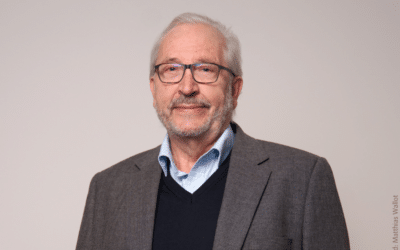Eine reibungslose Kooperation von Therapeutinnen und Therapeuten aus Psychotherapie und Allgemeinmedizin ist nützlich für alle Beteiligten. Diplom-Psychologin Friederike Echtler-Geist aus dem Stuttgarter Praxiszentrum Psychotherapie beschreibt Eckpunkte für erfolgreiche Kommunikation und Vernetzung.
„Gleich zu Beginn der Behandlung schreiben wir einen Arztbrief“, erklärt die Psychotherapeutin. Das Schreiben enthält mindestens den Aufnahmebefund und die Diagnose. Für sie ist das der Einstieg in die gegenseitige Information und ein wichtiger Baustein für die Vernetzung. Im Rahmen der Selektivverträge ist dieser erste Arztbrief Standard. „Für uns Psychotherapeuten ist das bei den vielen Patienten natürlich ein ziemlich hoher Aufwand“, führt sie aus, „aber die gegenseitige Information hat sich als sehr hilfreich erwiesen – auch für die Patienten“. Damit ist der Grundstein für eine gute Kooperation gelegt.
So geschmeidig war die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizin und Psychotherapie nicht immer. „Patienten mit psychischen Störungen werden von Hausärzten nicht immer erkannt und entsprechend selten an Psychotherapeuten oder Psychiater überwiesen“, hieß es 2011 in einem Ärzteblatt-Artikel. Das hat sich offenbar geändert, jedenfalls sieht Echtler-Geist die Situation deutlich positiver. Die „Flut der Anfragen und die hohe Zahl der Überweisungen“ zeigen ihr, dass sich die Sensibilität für psychische Erkrankungen deutlich erhöht hat. Ihrer Erfahrung nach werden Beschwerden wie Depressionen oder Angststörungen in den hausärztlichen Praxen ernst genommen und keinesfalls mit unzureichenden Mitteln behandelt. „Die Hausärztinnen und Hausärzte können gut einschätzen, dass Psychotherapie einen hohen Stellenwert besitzt“, sagt sie.
Mit der Form der Überweisungen hat die Psychotherapeutin keine Probleme. „Manchmal fehlt die Diagnose oder sie bestätigt sich nicht“, berichtet sie. Ein Drama? Keinesfalls! „Daraus würde ich nie jemandem einen Vorwurf machen. Die Psychotherapie ist doch unser Fachgebiet, also sind wir auch für die Diagnostik zuständig!“ Und eine psychiatrische Diagnose ist bekanntlich nicht mal in wenigen Minuten machbar, sondern braucht Zeit, die in der Hausarztpraxis meistens fehlt. Besonders bei neuen Patientinnen und Patienten ist eine sorgfältige psychiatrische Diagnostik in der Hausarztpraxis wohl kaum zu leisten.
Wichtige Aspekte der Kommunikation zwischen Hausarztpraxis und Psychotherapie sind die körperliche Abklärung psychischer Probleme und die Medikamentenanamnese. Echtler-Geist freut sich, wenn zuweisende Ärztinnen und Ärzte über Befunde wie Laborwerte oder Schilddrüsenprobleme informieren. „Der Hinweis, dass körperliche Ursachen abgeklärt wurden, ist ein super Service für uns“, berichtet sie.
Ein Dauerbrennerthema ist natürlich die Erreichbarkeit von Therapeutinnen und Therapeuten. Noch immer hat nicht jede Praxis – egal welcher Fachrichtung – eine funktionierende E-Mail. Und selbstverständlich freut sich niemand über erfolglose Versuche am Telefon. „Die meisten Hausärztinnen und Hausärzte sind während der Sprechstunde genauso schlecht zu erreichen wie wir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“, lacht sie.
Ruth Auschra