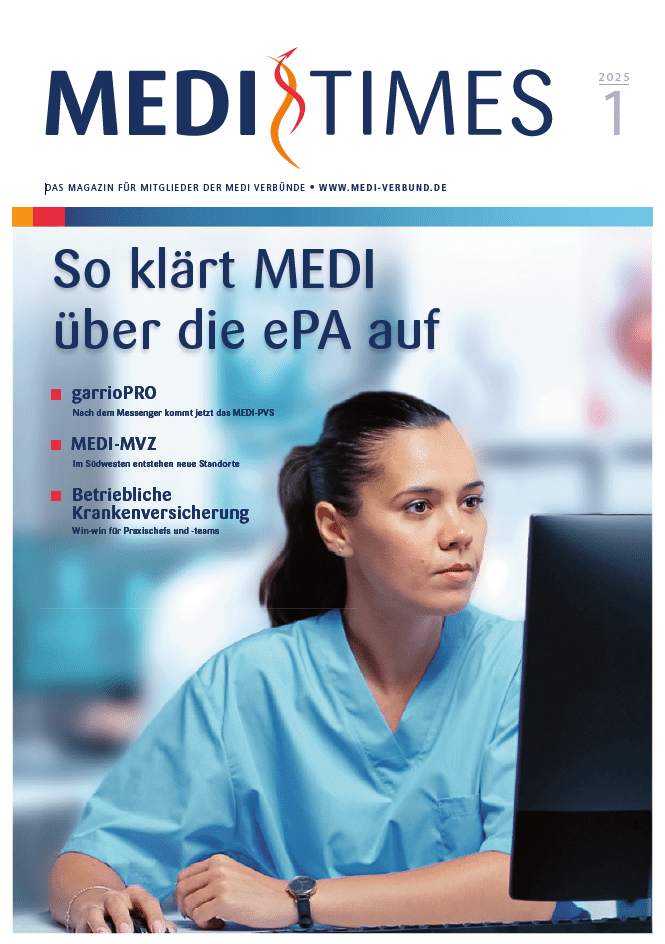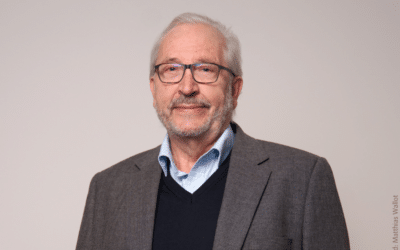Im Oktober 2017 hat das Weiße Haus in Washington die Abhängigkeit von „opioid pain killers“ zum nationalen Notstand in den USA erklärt. Ist so eine Entwicklung auch in Deutschland vorstellbar? Schmerztherapeut Dr. Dietmar Beck verneint. In seinem MEDIVERBUND CAMPUS-Vortrag erläutert er die Einzelheiten.
In den letzten 20 Jahren sind etwa 500.000 Menschen in den USA an einer Überdosis von Opioiden gestorben. „Dramatische Zahlen, aber man sollte sich vor Augen halten, auf welcher Grundlage die Opioid-Epidemie in den USA entstanden ist“, erklärt Dr. Dietmar Beck, der bis Ende Mai 2021 Leitender Arzt des Palliative Care Teams Stuttgart war. Auslöser der Krise war wohl eine zumindest teilweise fehlerhafte und extensive Behandlung mit Opioiden. So wurden Patienten nach mittelschweren Operationen früh entlassen – und gegen die Schmerzen gab es Opioide. Ärztlich verordnete Medikamente wurden so zum typischen Start einer Suchtkarriere; später stiegen die Abhängigen auf Heroin, Fentanyl oder Tramadol um, das sie sich auf dem Schwarzmarkt besorgten.
In Deutschland
Die Situation bei uns sieht glücklicherweise anders aus. „In Deutschland wird eine notwendige postoperative Schmerztherapie in der Klinik beendet oder der Patient bekommt ein nicht-opioides Analgetikum für den häuslichen Bedarf“, so Beck. Die Indikation für Opioide bei nicht-tumorbedingten Schmerzen sollte kritisch, zeitbegrenzt und möglichst als Teil eines multimodalen Konzeptes gestellt werden. Der Facharzt für Anästhesiologie erinnert sich gut daran, wie er zum ersten Mal von Oxycontin® hörte: „Ein schwieriges Präparat, das etwa zu 70 Prozent retardiert und zu 30 Prozent schnell freigesetzt wurde – diese Kombination widersprach unseren Grundannahmen von Schmerztherapie!“
Alter und Lebenserwartung spielen eine Rolle
Für Beck ist es selbstverständlich, bei der Indikationsstellung zur Schmerztherapie Alter und Lebenserwartung der Patienten zu berücksichtigen: „Ein 40 Jahre alter Mensch mit Schmerzen nach Bandscheibenoperation braucht eine adäquate Schmerztherapie, aber er darf natürlich nicht in einen Opiatabusus geraten.“ Anders als in den USA üblich wird in Deutschland großer Wert auf eine enge Führung der Schmerzpatienten gelegt, immer unter Berücksichtigung von Leitlinien zur Palliativmedizin und zu nicht-tumorbedingten Schmerzen (LONTS).
Nicht jeder Tumorpatient, der unter Schmerzen leidet, braucht Opioide. Beck zitiert den Merksatz: „Es müssen gute Gründe zur Opioidbehandlung bei nicht-tumorbedingten Schmerzen vorliegen und es muss gute Gründe zum Nicht-Einsatz von Opioiden bei Tumorschmerzen geben“. Typischerweise steigt die Notwendigkeit einer Opiattherapie in den letzten Lebenswochen oder -monaten an. Nicht immer ist eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) nötig. „Normalerweise wird der Patient vom Hausarzt weiter betreut und bis zum Sterben begleitet“, so Beck.
Die Indikation zur SAPV besteht definitionsgemäß, wenn ein komplexes Symptomgeschehen die Möglichkeiten oder Kompetenzen der Primärversorger übersteigt. „Etwa, wenn die Gefahr der Entgleisung nachts oder am Wochenende besteht“, konkretisiert der Palliativmediziner. „Die Einbeziehung der SAPV ist in Baden-Württemberg prinzipiell gut möglich“, weiß er, „wobei sich die Situation auf dem platten Land anders darstellen kann als in der Großstadt“.
Ruth Auschra