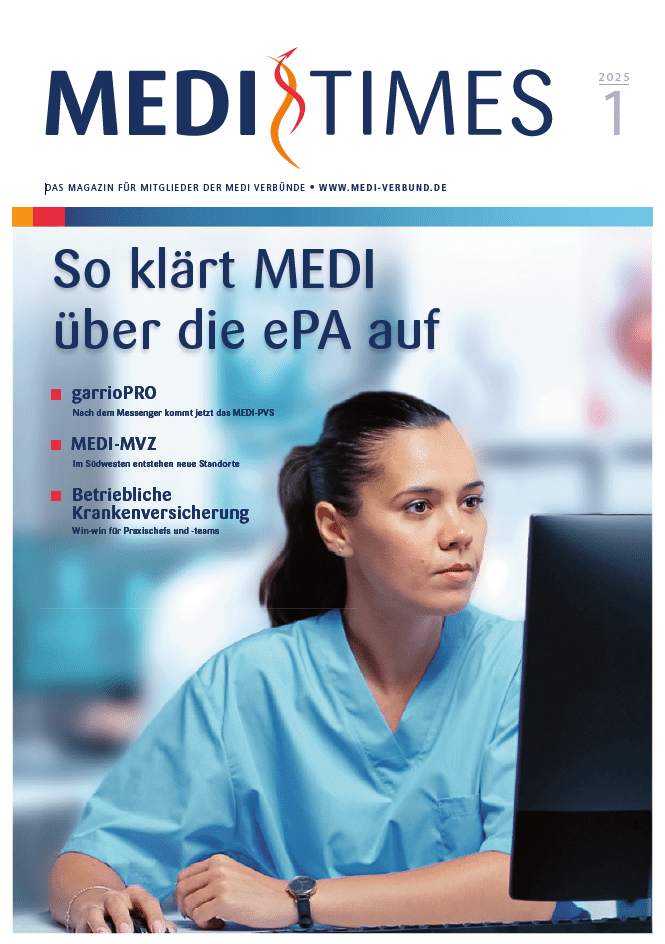Die Übermittlung einer schweren Diagnose stellt nicht nur für Patienten eine Ausnahmesituation dar, sondern auch für Ärzte. Wie kann das schwierige Gespräch für beide Seiten der Situation entsprechend gut verlaufen? MEDI hat sich bei Experten umgehört.
An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) werden Studierende schon zu Beginn ihres Medizinstudiums auf die Kommunikation mit Patienten vorbereitet. Seit 2005 bietet die MHH in ihrem Modellstudiengang einen intensiven Praxisbezug. Dr. Stefanie Sperlich ist Sozialwissenschaftlerin und Privatdozentin für medizinische Soziologie. Sie übt mit jungen Studierenden ab dem zweiten Studienjahr, wie schwere Diagnosen im Patientengespräch übermittelt werden. Dabei arbeitet sie auch in Rollenspielen mit Laienschauspielern und Betroffenen aus Selbsthilfegruppen.
Aktiv zuhören und Zwischentöne wahrnehmen
„Zu Beginn erarbeiten wir theoretische Grundlagen einer Gesprächsführung. Dabei spielt das aktive Zuhören eine wesentliche Rolle. Es geht darum, sich ganz auf die Patientinnen und Patienten einzulassen, Zwischentöne wahrzunehmen, nicht nur Beschwerden. Die Studierenden lernen, sich für den ganzen Menschen mit seinen Bedürfnissen zu interessieren“, berichtet Sperlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt: „Nicht zu viele Informationen kommunizieren. Damit fühlt man sich als Behandelnder zwar erst mal auf der sicheren Seite, aber man sollte schauen, was das Gegenüber eigentlich möchte. Ist er oder sie überhaupt in der Lage, alles aufzunehmen? Die Bedürfnisse sind sehr individuell“, so Sperlich.
Aber was kann man tun, um Patienten zu erreichen? „Sich trauen, zu fragen“, weiß Sperlich. Mit Fragestellungen wie „Wie geht es Ihnen? Welche Informationen wünschen Sie sich von mir?“ kann man sein Gegenüber erst mal abholen. Statistiken oder Überlebenswahrscheinlichkeiten sollten laut Expertin nicht kommuniziert werden. Alternativ können die Befunde lieber mit eigenen Worten umschrieben werden, wie beispielsweise: „Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt anhand der Befunde davon aus, dass …“ Dabei seien konstruktive und motivierende Worte im Falle einer Prognose auf Heilung wichtig.
Positive Arzt-Patienten-Beziehung wirkt stressreduzierend
Auch die Arzt-Patienten-Beziehung spielt laut Sperlich eine Rolle: Sie habe sich in den vergangenen Jahren positiv verändert – hin zu mehr Patientenzentrierung. „Patienten gestalten die Therapie aktiv mit und sind dadurch motivierter“, weiß Sperlich. Die gute Atmosphäre wirkt sich auch stressreduzierend aus. Das belegen sogar klinische Studien: „Eine gute Interaktion wirkt sich nachweislich positiv auf klinische Parameter wie Blutzuckerspiegel oder andere Blutwerte aus“, so die Wissenschaftlerin.
„In einer Hausarztpraxis gehört die Überbringung von schweren Diagnosen nicht zum täglichen Geschäft. Die organisatorischen Rahmenbedingungen in einer hochfrequentierten Praxis sind dafür kaum geschaffen. Sich eine halbe Stunde Zeit dafür einzuräumen ist fast nicht möglich, aber unbedingt nötig“, weiß Dr. Michael Ruland, Hausarzt und Psychotherapeut und stellvertretender MEDI-Vorstandsvorsitzender.
Umso wichtiger ist es, auf solche Patientengespräche gut vorbereitet zu sein. „Der Perspektivwechsel ist sehr hilfreich. Der Arzt oder die Ärztin kann sich die Fragen stellen: Wie würde ich selber gerne informiert werden? Was löst der Gedanke an eine schwere Erkrankung bei mir aus? Und was kann sich auf die Beziehungsleistung positiv auswirken?“, empfiehlt Ruland.
Supervision wichtig zur Einordnung und Reflexion
Einen entscheidenden Einfluss auf die Gespräche hat für Ruland vor allem auch die Erfahrung damit. „Schlechte Erfahrungen, die jemand als Übermittler schwerer Diagnosen gemacht hat, nehmen großen Einfluss auf die Qualität der Gespräche“, weiß der erfahrene Psychotherapeut. „Wenn diese Situationen in einer Supervision nicht aufgearbeitet werden, können solche Gespräche zu sehr ungeliebten, aber unvermeidlichen Situationen werden“, so Ruland. Als Hausarzt und Therapeut nutzt er selbst seit vielen Jahren Supervision.
Die Möglichkeit, belastende Situationen mit Dritten zu reflektieren, hält er für besonders wichtig – gerade bei der Kommunikation schwerer Diagnosen. Dabei muss nicht immer zwingend mit einem dafür ausgebildeten Therapeuten gearbeitet werden. „Schon der regelmäßige Austausch über belastende Situationen mit Kolleginnen und Kollegen ist sehr wertvoll“, weiß Ruland.
Auch für Ruland ist eine gute Arzt-Patienten-Beziehung entscheidend: „Wir können die Beziehungspflege nur vernünftig betreiben, wenn bedarfsgerechte Supervision möglich ist.“
Tanja Reiners