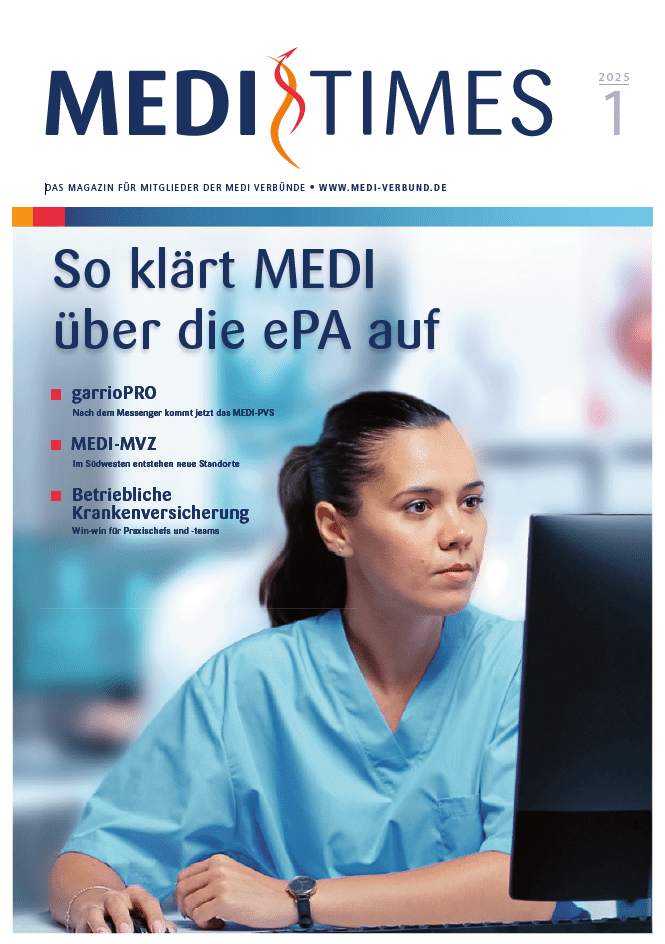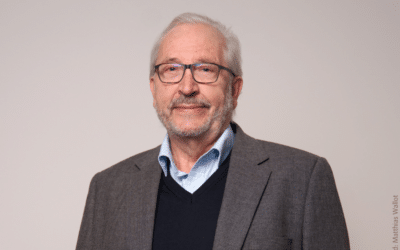In der „Stuttgarter Deklaration“ stellen heute niedergelassene und Krankenhausärzte vor, wie sie den Impfschutz von Patienten mit Immunsuppression und Immundefizienz verbessern werden. An der Deklaration haben 25 Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen mitgewirkt. Das Institut für fachübergreifende Fortbildung und Versorgungsforschung der MEDI Verbünde (IFFM) und MEDI Baden-Württemberg haben das Projekt koordiniert, nachdem das Bundesgesundheitsblatt auf den alarmierend schlechten Impfschutz immunsupprimierter Patientinnen und Patienten hingewiesen hat.
Die Ärzte haben am IFFM Lösungen ausgearbeitet und in der „Stuttgarter Deklaration“ zusammengefasst. Da Menschen mit Immunsuppression und Immundefizienz nahezu keine körpereigenen Abwehrkräfte haben, weisen sie ein höheres Infektionsrisiko und bei Infektionen eine höhere Sterblichkeit auf. Die Mediziner sind sich sicher, dass ein umfassender und besserer Impfschutz weniger Risiken für diese Patienten bedeutet.
Besserer Informationsfluss
Immuntherapien werden nicht nur bei onkologischen Erkrankungen angewendet. Erfolgreich – und dementsprechend immer häufiger – ist auch die Behandlung in der Rheumatologie, Pneumologie, Immunologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, Dermatologie, Neurologie, Kardiologie, Nephrologie und Pädiatrie. „Da Ärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen Immuntherapien anwenden, müssen alle Behandler über Besonderheiten bei Impfungen informiert sein“, erklärt Dr. Markus Klett, 2. Vorsitzender des IFFM. Wichtig sei ein guter Informationsfluss zwischen den Fachärzten, die Diagnosen stellen und eine Therapie einleiten, und den Haus- oder Kinderärzten, die weitgehend für die Impfungen zuständig sind.
„Unsere Deklaration ist eine Besonderheit“, ist Klett stolz. „Der interdisziplinäre Konsens umfasst intersektoral auch die beteiligten Krankenhäuser – ein Meilenstein in der ärztlichen Zusammenarbeit.“
Maßnahmenkatalog in der „Stuttgarter Deklaration“
Dazu gehört, neben verstärkter Patientenaufklärung, auch ein Impfkalender, der sich an den Empfehlungen der STIKO orientiert und für alle Behandler verbindlich ist. Jeder Patient soll einen individuellen Impfplan bekommen, den die behandelnden Haus- und Fachärzte in enger Zusammenarbeit auf der Grundlage des Impfkalenders erstellen.
Die „Stuttgarter Deklaration“ weist auch auf Besonderheiten während akuter Krankheitsschübe und der Immuntherapie hin. Außerdem klärt sie darüber auf, wann Lebendimpfstoffe und wann Totimpfstoffe verabreicht werden und welchen Impfschutz Kontaktpersonen aufweisen sollten, um keine Gefahr für die immungeschwächten Menschen darzustellen. Behandelnde Ärzte sollen einmal im Jahr die Anzahl der Impfungen überprüfen. Zudem soll die Verfügbarkeit von Impfstoffen sichergestellt werden, indem Ärzte, Apotheker, Impfstoffhersteller, Krankenkassen und Politik zusammenarbeiten.
Alarmierende Zahlen
Weniger als fünf Prozent der immunsupprimierten Patienten sind laut STIKO gegen Pneumokokken geimpft. In Baden-Württemberg werden mindestens 600.000 Menschen infolge verschiedener Krankheiten mit Immuntherapeutika behandelt. Zähle man Erkrankte hinzu, die momentan eine Therapiepause machen oder deren Immuntherapie noch nicht begonnen hat, müsse man von gut 800.000 Betroffenen im Land sprechen, so Klett. Allein in Stuttgart seien mindestens 35.000 Menschen betroffen.
Laden Sie hier die völlständige Stuttgarter Deklaration herunter.
Carmen Krutsch